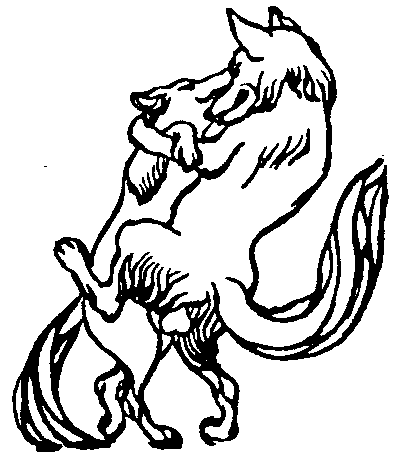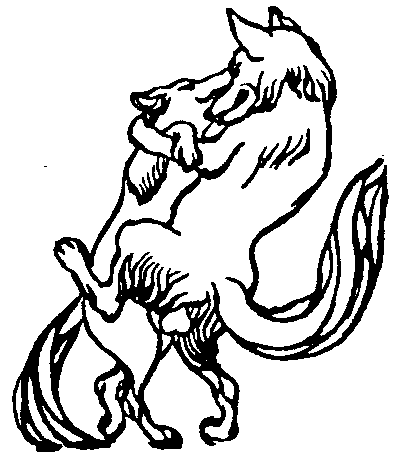
Die Fabel gehört zu den ältesten literarischen Arten der Weltliteratur, längst vor dem sagenhaften Sklaven Aesop (6. Jh. v. Chr.), der alte Fabeln sammelte und wohl auch neue erfand. Im Mittelhochdeutschen findet sich zunächst das Wort "bispel" (= zur Belehrung erdichtete Geschichten: Fabel, Gleichnis, Sprichwort). Seit Steinhöwels "Esop" (1476) versteht man auch in der deutschen Sprache unter Fabel eine Tiererzählung (Pflanzen oder Dinge sind seltener), die als Beispiel gelten und dem Leser zur Lehre dienen will.
In der neueren deutschen Literaturgeschichte greift besonders die Reformationszeit (Luther, Melanchthon u.a.) die Fabel auf, und das aufklärerische 18. Jahrhundert gibt ihr eine ganz zentrale Funktion. Gottsched, Breitinger, Gellert, Lessing, Herder u.a. beschäftigen sich mit der Fabeltheorie und suchen diese auch durch eigene Beispiele zu bekräftigen. Im 20. Jahrhundert setzen Autoren wie Kästner, Thurber, Risse, Schnurre, Krüss, Kirsten u.a. die Fabel-Tradition fort. Dabei wird freilich eine gewisse Verschiebung in der Form wie in der Aussage deutlich. Das Denkmuster des Aesop-Typs konnte bis zur französischen und industriellen Revolution gelten.
Die Fabel hat als didaktische Literaturform im Lauf der Geschichte verschiedene Lehren vermittelt. Eine aggressiv-sozialkritische Funktion kann häufig beobachtet werden. Daneben gibt es jedoch auch weniger spezifisch politische Aussagen, z.B. über kluges Verhalten, über ethische Fragen, über religiöse Standpunkte. Einige der handelnden Figuren begegnen immer wieder: Hahn, Fuchs, Wolf, Lamm, Löwe, Maus, Katze, Esel. Gerade diese Tiere verfügen denn auch über eine relativ feststehende Charakteristik, die jedoch immer erst durch die jeweilige Gegenüberstellung endgültig bestimmt werden kann. In der Regel treten zwei Figuren oder Parteien auf.
Dieser antithetische Charakterzug der Fabel ist übrigens häufig schon in der Überschrift zu beobachten. Die beiden Kontrahenten sind oft Vertreter der Positionen Überlegenheit - Unterlegenheit (z.B. Macht - Ohnmacht, Reichtum - Armut, Hochmut - Bescheidenheit, Hinterlist - Arglosigkeit usw.). Ein für die Fabel typischer Handlungsschematismus - bei weitem aber nicht der einzige - liegt dann in der Umkehr der Anfangssituation: Der ursprünglich Unterlegende erscheint dann am Ende als der eigentlich Überlegene.

Ein wesentlich wichtigeres Charakteristikum der Fabel liegt jedoch darin, dass die vorgeführte Tier-Handlung (= Bildebene) immer für menschliche Verhältnisse signifikant wird (= Sinnebene). Die Tiere (und entsprechend die Pflanzen und Dinge) der Fabel sind also niemals instinkthaft im naturwissenschaftlichen Sinn zu begreifen, sondern als für ihre Denk- und Handlungsweisen voll verantwortliche Wesen, wie Menschen. Auch das Epimythion (die Moral, die Lehre oder ein Merke), das gelegentlich einer Fabel mitgegeben wird, thematisiert eindeutig diesen Sachverhalt. Damit erscheint die Fabel als eine verschlüsselte Aussage. Sie bezieht sich immer auf eine ganz konkrete Situation, aber der Bezug ist nur herzustellen, wenn der Code erkannt wird.
Die Fabel verbirgt also zunächst das Gemeinte, um es am Schluss desto überzeugender demonstrieren zu können. Die Übertragung der aktuellen Problemlage ins Bild und die damit verbundene Distanzierung, Vereinfachung und Zuspitzung sind wirkungsvolle rhetorische Mittel. Mit ihrer Hilfe kann er dem Mächtigen belehrend, korrigierend, kritisierend, drohend, ja sogar satirisch spottend gegenübertreten (Aesop und Phaedrus waren Sklaven). Insofern ist für die meisten Fabeln die Kenntnis des historisch-politischen Kontexts eine wichtige Voraussetzung zum Verständnis.

Die Fabel ist in der Regel kurz und stellt klare, leicht überschaubare Handlungseinheiten vor. Dies erleichtert das mehrfache Lesen unter verschiedenen Aspekten und kommt einer intensiven Arbeit an Wort und Satz entgegen. Die Figurencharakteristik bietet sich schon durch die starke Kontrastierung an. Zunächst ist es wichtig, die Fabel von der Tierdichtung abzusetzen.
Gute Tiererzählungen versuchen, das Tier in seinem naturbedingten Wesen zu erfassen. In der Fabel dagegen ist das Tier kein Stück Natur, sondern hinter dem Tier steht der Mensch; und die zwischen Fuchs, Esel, Hahn usw. sich entfaltende Handlung kennzeichnet zwischenmenschliche Verhältnisse.